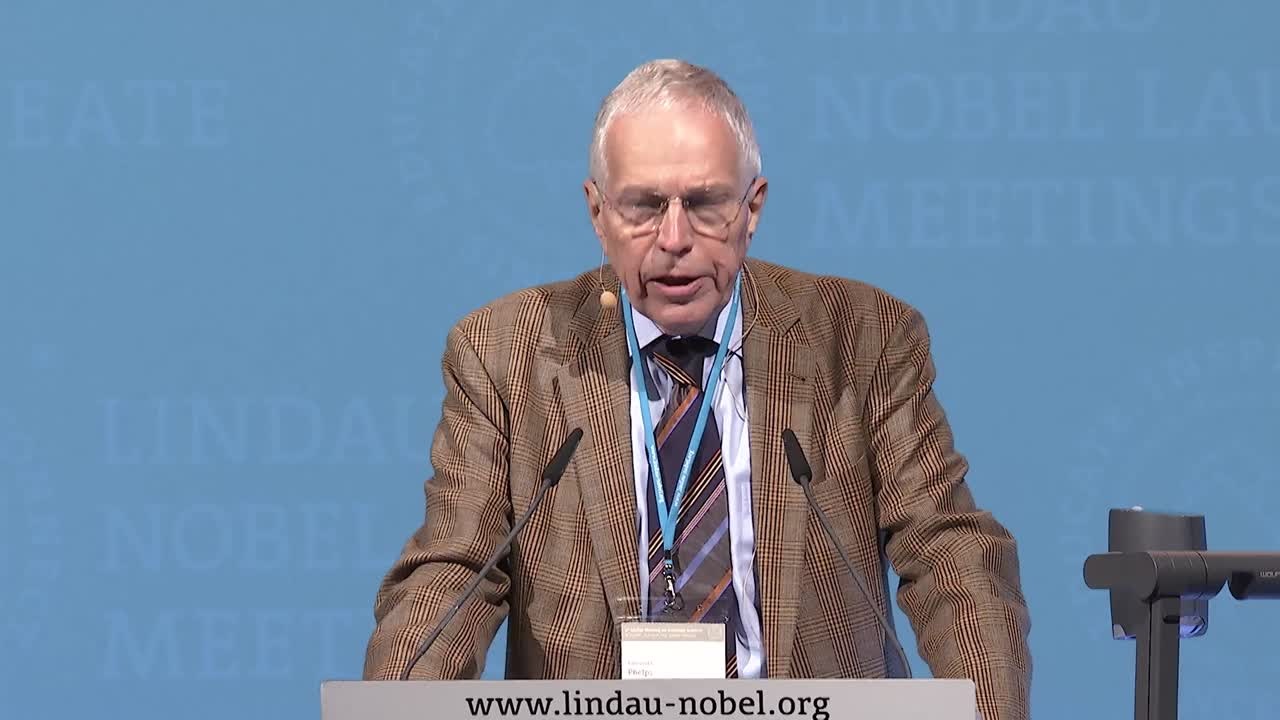Good morning, great to see all of you.
Well, now for something a little different.
My talk is about how we need to change macroeconomics and in fact economics more broadly.
What is the economics that we have today?
I think it’s fair to say that the economics predominantly practiced today by professionals is
what you might call neo, neoclassical, neo plus stochastic with an overlay of Keynesian theory from
which the unknowable animal spirits and the murkiness of long term expectations have all been removed.
Now some abstraction is fruitful but this standard economics
which succeeded in meeting a number of earlier problems
is not meeting the syndrome of problems faced by the west for some decades:
lethargic growth, depressed employment levels, expressions of job dissatisfaction
and in several countries continual state borrowing.
Using the policy tools given us by standard economics the west may obtain symptomatic relief from the illness but not a cure.
This failing of our beloved economics arises of course because it does not explain the causes of those problems.
In my view and that of a number of others the symptoms I cited
have their roots in the losses some decades ago of much of the innovation
that for more than a century energised economic growth and economic life itself.
These losses have cost us much of our prosperity.
Even the recent rise of wealth inequality in some economies can be linked to those losses.
In the standard economics all innovations observed in a country are exogenous to it.
Innovation is the name given to a shift in some technological parameter which is unexplained.
But we economists can make the effort to understand the kind of innovating
that is indigenous or home grown and most of which germinates in the economy rather than being exogenous to the economy.
How much indigenous innovation nations achieve is important for their performance.
There’s no doubt that indigenous innovation is a real phenomenon.
There appears to be a significant level of indigenous innovating going on in China today.
It was largely indigenous innovation that broke out in the 1800’s first in Britain and America, later Germany and France.
And it is much of this innovation that has been lost.
There is also no doubt it yields, this indigenous innovation yields material benefits
and its processes offer non material rewards of immense value.
Increasingly the west is recognising the importance of regaining the dynamism that sparks indigenous innovation.
However to understand the deep roots of such dynamism and the deep satisfaction
that an economy high in dynamism offers to participants
we have to have the rudiments of a theory of indigenous innovation, its nature, sources and desirability.
Yet the economics taught in graduate schools does not and cannot offer such a theory.
Its narrow confines leave no room for indigenous innovation.
Developing a theory of indigenous innovation requires going outside standard economics.
That is something that my recent book “Mass Flourishing” aims to do.
So this lecture to you advanced students is an opportunity for me to discuss these issues at a somewhat more technical level.
Let me talk first about the unknowns. First the issue of knowledge.
Text book economics postulates so called rational expectations about the future.
It goes way beyond rationality in the everyday sense, not just rational expectations about what your neighbour is up to.
And that premise of RE as we call it implies
that a nation’s economy will not be in the business of creating and adopting new products or methods.
It will not be doing indigenous innovation. Why not?
Well if the economy were found to be innovating, thus using new methods and products never conceived before,
that would by definition be unexpected and that would contradict the premise of rational expectations,
which says that there’s fundamentally nothing that’s unexpected.
So the models using RE, rational expectations, and the phenomenon of indigenous innovation do not mix.
RE models are deterministic. While any economy with the dynamism to pursue indigenous innovation is open,
as Carl Pauper would have put it, open to creating its future.
A dynamic economy’s future is not predetermined.
Now, I hope the next couple of paragraphs are reasonably clear.
But if they’re not very clear don’t worry about it.
We’ll be sailing into smoother water in a few minutes.
Some Neo-Schumpeterians seem to get around the problem by defining an innovation
as something like stumbling on the occasional 5 dollar bill on the street.
These theorists, some of them good friends of mine, describe an essentially stationary economy in the mathematical sense.
Calendar time does not enter in any equation.
A stationary economy in which the so called innovations are governed by a linear birth process with a known probability of birth.
In this model the probability distribution of the cumulative innovation up to any specified future date could be calculated.
So in that sense the future in a probabilistic sense is determined. It’s probabilistically determined.
The model excludes genuine innovation by implying and making very explicit
that nothing new is ever learned about the economies’ potentialities,
what products could later prove producible or valuable.
There is no discovery process in Hayek’s sense.
There cannot be any new economic knowledge in this Neo-Schumpeterian world
because the structure of possibilities and their probabilities is already known.
In the innovative economies that Britain, America, Germany and France acquired in the 19th century
the probabilities and even the possibilities were never really known. That’s for sure.
Schumpeter himself, I mentioned the Neo-Schumpeterians, Schumpeter himself thought
that he had reconciled standard economics with innovation.
He saw there was occasionally new knowledge of what could be produced but he proposed or supposed
that it came from outside a nation’s economy.
It came with the discoveries of the world’s explorers and scientists.
The guy who articulated that before Schumpeter was Arthur Spiethoff in 1904 by the way.
When the scientists or navigators make a discovery, the entrepreneurs in every advanced capitalist economy jump
to exploit the what he calls obvious applications of the new knowledge.
Unless we don’t get it, he tells us at one point that entrepreneurs have zero creativity.
Cleary this new knowledge of products and methods, this Schumpeterian innovation, is basically exogenous to a nation’s economy.
It’s available to all nations, those willing and able to put together the required organisations
and the required investments at any rate.
But I maintain that the innovating that began shaking the world from 1815 or so to 1940
and at a reduced pace in some countries to 1965 or so was mostly indigenous.
Yet most historians, even many economic historians, I think of Joel Mokyr for example,
who has tangled with me in the past few months, or earlier I think Douglas North
and with time I probably could think of a great many others,
they go on interpreting the innovation in the high innovation economies as fundamentally Schumpeterian
in attributing economic advance basically to the growth of scientific knowledge
rather than a growth in the stock of business ideas which results from business people looking around
and thinking and imagining and experimenting, trying things out, tinkering and so forth.
Their thinking, I tried to understand what underlies this,
their thinking seems to be that scientific knowledge historically always or reliably grows faster
than the stock of business ideas.
Or else the growth of the former scientific ideas is more effective in producing economic advance
than the growth of business ideas.
Schumpeter himself said that an advance in scientific knowledge...
He pointed out that a discovery by scientists or explorers had to be combined with entrepreneurship.
And he is evidently thinking of the knowledge that entrepreneurs have about
how the economy works and what is produced and what cannot be produced.
So in a way Schumpeter is introducing the point that economic knowledge matters too
so that when there’s a jump of scientific knowledge the level of economic knowledge is going to matter.
Likewise the modern theory that I’m proposing, which emphasises the indigenous innovation,
might be formulated in such a way as to say
that the advance in the stock of innovative business ideas may have to be combined with a little bit of scientific knowledge.
So the symmetrical opposite to Schumpeter.
So what I am calling dynamism is not just the propensity to have new ideas.
The effectiveness of the new ideas matters.
I think the Schumpeterians went wrong in the following way.
It’s surely right that the level of knowledge possessed by business people is quite important for their capacity to innovate.
Yet that should not suggest to us that the spectacular outpouring of new products and new methods from the 1820s to 1940
resulted more from the further accumulation of scientific ideas than from the accumulation of business ideas.
We know almost nothing about that matter.
We just know that knowledge is important in various kinds.
And new ideas are important.
Furthermore, while a nation’s capacity to innovate depends to an extent on knowledge possessed by producers and users
that knowledge doesn’t mean just scientific knowledge.
It also means industry expertise, literacy, a bit of mathematics
and depending on what you’re doing musicology or painting theory or whatever.
The Schumpeterians are making a fetish out of science.
And the economists just sit back and accept that unquestioningly which is a colossal mistake.
So, I’ve talked about dynamism.
I’ve used the term several times but I haven’t really said very much about it.
Dynamism is the thing that exists, that has to exist in a society for it to generate indigenous innovations.
So more precisely what are the elements of this dynamism and what are their source?
To be sure widespread innovative activity would not have taken place in the 19th century
without a range of economic freedoms and institutions.
There also had to be a commercial culture.
A company depends on a general adherence to implicit typically unenforceable contracts, a culture
that demands keeping ones promises.
But an economy can have all the latest institutions and an enviable commercial culture
without having the spark for innovation certainly on a mass scale,
in other words, without having enough dynamism to generate a high rate of indigenous innovation.
The elements of dynamism as I see it are the latitude to innovate and the capacity to innovate and above all the desire.
To have a broad flow of indigenous innovation society has to allow businesses wide latitude to innovate.
There is less leeway for innovations if society is unwilling to put up with the disruption and inconvenience that often,
but not always, accompanies innovation.
There is still less leeway for innovation if elites in many corporatist nations
can block outsiders having new ideas from entering their industries or if the industries
where start-ups could have entered are fenced off from new competition by governmental protections of the established firms.
Patent claims and threats of lawsuits are daunting hazards for anyone who would start a firm in hopes of achieving an innovation.
What’s this capacity to innovate?
Well, one's capacity to innovate depends on one’s human personal resources, most familiarly one's knowledge.
Any innovation is apt to require some special knowledge as well as adequate general knowledge.
Although in the early days many innovators were notorious for their illiteracy or innumeracy.
Innovators in the music business must know something about composition theory.
Those in pharmaceuticals must know something about chemistry.
It is widely thought that virtually all innovation these days
requires knowledge of science, information technology, engineering and mathematics.
But that view incorrectly assumes that the only remaining possibilities for innovation these days are in high tech areas.
And that’s a totally unsubstantiated hypothesis and rather absurd I think.
This capacity to innovate also requires mental resources that are rarely found all in one person.
Foremost among these are imagination and creativity.
Those are the 2 most important words in my talk this morning.
But like everybody else in the world I don’t have an awful lot to say about imagination and creativity except
that, wow, are they important to innovation.
Scepticism is also important.
Innovators tend to be people who readily question prevailing beliefs and are willing to think for themselves.
Another rare resource needed by innovators is insightfulness.
It’s not enough to create new stuff.
You have to create the right new stuff.
Henry Ford had a vision and it was right on the money.
He didn’t just build a new car.
As a matter of fact he liked to go around insisting there was nothing new in that car.
Not a single thing was in that car that hadn’t been already in the cars made by competitors in Detroit.
It was the conception of the demand that such a car would find.
To attempt an innovation is to embark onto the unknown.
To undertake such a journey aspiring innovators have to feel they have sufficient understanding to warrant making a start
which may require long stretches of solitary thought and they have to feel
they will be able to bear failure in the event their venture does not succeed,
obviously the capabilities that are common to entrepreneurs.
The hustle, the extroversion and the judgement that comes from experience
that’s an entirely different kettle of fish from the capabilities of innovators.
At the heart of dynamism however is the desire to innovate.
Despite the obstacles or maybe in some part because of the obstacles
some innovators have a deep need to show others their great imagination or rare grasp
by creating something that is new, that is embraced and recognised.
Stravinsky enjoyed saying that he had written his great compositions
to show the friends of his parents how good he was and by the time he’d finished the friends of his parents were all deceased.
Some innovators are driven by curiosity to see whether their insight is proved right
whether the new thing could be made at a sufficiently low cost and whether it could win a sufficiently large market.
Other innovators are driven by a need to prove themselves...
to prove themselves that they can succeed, not their parent's friends.
Obviously these motives and aspirations are not the work and save mentality of mercantile capitalism
about which Max Weber famously wrote around 1920.
These aspirations and motives underlying the desire to innovate were,
I maintain, stirred by the modern values that began to immerge as early as the late Renaissance.
The individualism of Pico Della Mirandola and Luther.
Taking charge of one’s life which entails thinking for oneself and the willingness to break from convention.
The vitalism portrayed by Cellini, Cervantes and Shakespeare
relishing challenges, surmounting obstacles and making a mark
and finally the expressionism or experimentalism of Kierkegaard and Nietzsche,
the thrill of fascination of venturing into the unknown and the self-discovery that results.
These values steered people on a course to pursue careers offering personal growth,
the becoming that Montaigne and Henri Bergson wrote about famously.
As people created the new, they created themselves.
These modern values were in sharp contrast to the traditional values of medieval or ancient times.
And what were those in particular?
Materialist values undermining exploration for its own sake, communitarian values
opposing new businesses and new money and family values, impeding breaking away and taking big chances, betting the ranch.
After a long gestation the modern values I argue gave birth to what I call the modern economy,
an economy rich in dynamism down to the grass roots of society.
Massive numbers of people including ordinary people
were frequently observing, exploring, tinkering, imagining, conceiving, creating, experimenting, testing and marketing.
Many were examining, trying out and venturing a possible adoption as new products came out.
One result was an explosion of innovation as evidenced by the unprecedented climb of productivity from around 1820 to 1940
and less steeply to around 1965 in the United States.
That was one result of the explosion of innovation.
Another result was the changed way of life.
Now there was a guy whom you may have heard of, a lawyer who was beginning to run for office around 1858.
And he’d learned an awful lot about the American people in the course of his numerous exchanges and experience.
And he decided to write a lecture about it.
The title is invention something or other and something or other.
He should have called it innovation but that’s ok.
And that man was Abraham Lincoln.
And turns out the second lecture was actually the first lecture but it’s too late and everybody has called it the second lecture.
And I that second lecture he says: “Young America has a great passion, a perfect rage for the new.”
And one might understand him to have meant that people have a good time in the shopping mall.
But I think he meant something wider.
That people were just into novelty when working as well as when shopping.
Now I maintain that this was a good economy.
For me the lone shepherd bored by the routine and isolated from exchanges with others
symbolises the stasis and stultification that was characteristic of the pre-modern economies as in mercantile capitalism.
The modern economy replaced boredom with mental stimulation, isolation with interchange within companies and within cities.
A new dimension of prosperity appeared, one that was experiential
rather than directed to an end such as increased consumption or wealth.
The journey is the reward as the adage has it.
Modern people experienced broadly for the first time what is referred to as prospering or thriving.
There is a material prosperity that comes from obtaining improved terms for one's work
and that comes from access to this experience.
There is also the non-material kind of prosperity that derives from taking on challenges
and creating in the hopes of adoption and recognition.
The modern people were experiencing what philosophers call the good life, a life of flourishing
which philosophers now agree is the word that Aristotle should have used but maybe the word didn’t exist at that time.
And Aristotle used the word happiness, unfortunately.
It’s clear to me that we have to rework the standard economics
if it is to be applicable to all those issues where the dynamism for indigenous innovation is a crucial consideration.
For one thing bringing dynamism into the analysis will shed new light on what a nation should want from its education system.
It will also shed new light on the origins of wealth inequality.
I don’t want to run too much over time.
So let me just jump to something that I know your itching to hear about.
That is inequality. And here’s what I have to say about it.
When I finished my book Mass Flourishing, the subject of inequality had not become the rage.
And I don’t think there’s even, the word is not even in the index.
And then Piketty came along.
And everybody was reading Piketty and very few people were reading my book “Mass Flourishing”.
So I decided I’ve got to write about inequality too.
Well I can’t get it into the book now.
I don’t think Princeton University Press is going to allow that for quite a while.
But I did write something in the Financial Times about a month ago.
A little bit of disguised economic theory which they allowed into the paper.
New voices are calling our attention away from those problems I was talking about,
the slow growth, the depressed employment, the expressions of low job satisfaction.
And they’re calling our attention to inequality.
In Europe they estimate one quarter of private wealth is held by the wealthiest 1%, in America one third.
This wealth has ballooned relative to national income in countries where growth has slowed
and the share held by the rich has risen in most nations over recent decades.
Now I want to say, I have to say that I have a career long interest in economic justice
and hence in unjust inequalities going back to the 1960’s and 1970’s.
So I am not deaf to this new discussion.
I found myself asking though is the decline of indigenous innovation in the west
possibly a cause of the increased wealth inequality.
I just skipped a 3 page section in which I talk about the decline of innovation.
And the evidence for that is of course an abrupt slowdown in the rate of growth of total factor productivity in America in 1972.
If you want further evidence you can look at the rate of return to investment.
Is innovation propping up the rate of return to investment as it always has in the past?
No. After 1972 the rate of return to investment fell.
Now it’s interesting. The rise of wealth inequality could be viewed as another symptom of this slowdown of innovation.
Let me come quickly to the point.
I argue that losses of the dynamism that sparks innovation have tended to inflate wealth inequality.
The big innovation falloffs in the 1960s most importantly in the US hit labour harder than the wealthy.
Fewer projects to develop new products and fewer factories making capital goods that produce new products
most of which are quite labour intensive means a reduced share going to labour income.
Profits slid too on this account but the wealthy were partially invested overseas.
However the main point I want to say is that much of the losses of innovation have come from the spread of corporatist values,
particularly solidarity, security and stability.
And corporatist policies protecting labour and capital
through anti competition regulation, the catering after interest groups through pork barrel contracts and industrial policy,
these act to block or impede those who would try to innovate or would reduce their incentive to try to innovate.
Now what is the effect of that on the profit share?
When established companies find themselves with less competition to fear
because it’s become harder for innovators in most of the economy,
established firms are emboldened to raise their mark ups and thus their profits.
Competition doesn’t work to drive that share back down.
That in turn raises share prices, thus the wealth of the already wealthy share owners.
Let me just make 2 other very brief points.
Another corporatist value, materialism, likewise increases wealth inequality.
In standard economics people save out of their wages to acquire returns on wealth with which to spend more.
No one is a miser in an everlasting slog to more and more wealth in the standard theory.
The resurgence of materialism has brought just such a fixation on getting rich.
Data now show that people save even in their retirement. They’re still saving.
Like some sort of wind up dolls that can’t stop saving.
Last point, materialism has also led to shortermism.
It tempts CEOs to pump up share prices and fund managers to demand that CEOs hit their quarterly earnings targets
which is very distracting from any long run visions they might have.
Corporations raise bonuses through buy backs to pump up share prices.
All this adds downward pressure on innovation and buoys up wealth inequality.
After innovation gauged by productivity growth weakened in the United States between 1965 to 1975
that was the period of slowing profits as a share of GDP have climbed to record highs
and price earnings ratios are well out of the normal historical range.
Happily getting back our dynamism will not only increase employment growth and job satisfaction,
it will also shrink wealth inequality.
Thank you.
Applause.
Guten Morgen.
Schön, Sie alle hier zu sehen.
Jetzt zu etwas, das ein bisschen anders ist.
Mein Vortrag beschäftigt sich damit, wie wir die Makroökonomie und eigentlich die Ökonomie
im umfassenderen Sinne verändern müssen.
Was haben wir heutzutage für eine Ökonomie?
Ich glaube, man kann wohl sagen, dass die heute überwiegend von Profis praktizierte Ökonomie
als neoklassische Ökonomie bezeichnet werden könnte - neo plus Stochastik,
mit einer Überlagerung durch die Keynesianische Theorie,
aus der die irrationalen Elemente, „Animal Spirits“ sowie die Unbestimmtheit langfristiger Erwartungen eliminiert wurden.
Ein gewisses Abstraktionsmaß ist sinnvoll.
Aber diese Form einer Standardökonomie, die in der Vergangenheit zur erfolgreichen Bewältigung zahlreicher Probleme
beigetragen hat, eignet sich nicht für das Problemsyndrom, mit dem der Westen seit einigen Jahrzehnten konfrontiert ist:
lethargisches Wachstum, anhaltend schlechte Arbeitsmarktlage, Ausdruck von Unzufriedenheit mit der Arbeit
und in mehreren Ländern fortwährend Neuaufnahme von Staatsschulden.
Der Einsatz der politischen Instrumente der Standardökonomie verschafft dem Westen vielleicht
eine Linderung der Krankheitssymptome, aber keine Heilung.
Das Versagen unserer geliebten Ökonomie hängt natürlich damit zusammen, dass sie die Ursache dieser Probleme nicht erklärt.
Nach meiner Einschätzung und der zahlreicher anderer haben die von mir genannten Symptome ihre Wurzeln
in dem bereits vor einigen Jahrzehnten erfolgten Verlust eines Großteils der Innovationskraft,
die das Wirtschaftswachstum und das Wirtschaftsleben mehr als ein Jahrhundert in Schwung gehalten hat.
Diese Verluste haben uns große Einbußen in Bezug auf unseren Wohlstand beschert.
Selbst die aktuelle Zunahme der Ungleichheit in der Vermögensverteilung in einigen Volkswirtschaften
kann man mit diesen Verlusten in Verbindung bringen.
In der Standardökonomie sind alle beobachteten Innovationen in einem Land exogen.
Als Innovation wird eine noch ungeklärte Verschiebung von technologischen Parametern bezeichnet.
Aber wir Wirtschaftswissenschaftler können uns darum bemühen, die Art von Innovation zu verstehen,
die endogen oder eigenständig ist und die größtenteils innerhalb des Wirtschaftssystems entsteht, statt exogen darauf einzuwirken.
Das Ausmaß an eigenständiger Innovation von Nationen hat Bedeutung für ihre Leistungsfähigkeit.
Zweifelsohne ist die endogene Innovation ein reales Phänomen.
In China geschieht heute offensichtlich eigenständige Innovation in bedeutendem Umfang.
Und es war größtenteils endogene Innovation, die im 19. Jahrhundert zunächst in Großbritannien und Amerika,
später in Deutschland und Frankreich ausbrach, und ein Großteil dieser Innovation ist verloren gegangen.
Es besteht zudem kein Zweifel, dass diese endogene Innovation materielle Vorteile hervorbringt
und ihre Prozesse nicht-materielle Chancen von immensem Wert bieten.
Der Westen erkennt zunehmend die Bedeutung der Wiedergewinnung einer Dynamik, die endogene Innovation fördert.
Um allerdings die tiefen Wurzeln einer solchen Dynamik und die spezielle Befriedigung zu verstehen,
die eine dynamikstarke Ökonomie für die Beteiligten bedeutet, müssen wir die Theorieansätze der endogenen Innovation,
ihre Beschaffenheit, ihre Quellen und ihre Attraktivität verstehen.
Allerdings kann und wird die Wirtschaftswissenschaft, die in den Hochschulen vermittelt wird, eine solche Theorie nicht bieten.
Ihre engen Grenzen lassen keinen Raum für die endogene Innovation.
Die Entwicklung einer Theorie der endogenen Innovation erfordert einen Blick über den Tellerrand der Standardökonomie hinaus.
Den versuche ich in meinem aktuellen Buch „Mass Flourishing“ zu entwickeln.
Dieser Vortrag vor Ihnen als fortgeschrittenen Studenten ist für mich eine Gelegenheit,
diese Themen auf einer etwas technischeren Ebene zu erläutern.
Lassen Sie mich zunächst etwas zu den unbekannten Größen sagen.
Zuerst das Thema Wissen.
Die Lehrbuch-Wirtschaftswissenschaften postulieren sogenannte rationale Zukunftserwartungen.
Das geht weit über die Rationalität im Alltagssinne hinaus, nicht nur rationale Erwartungen darüber, was Ihr Nachbar vorhat.
Und diese Prämisse der RE, wie wir sie nennen, impliziert,
dass eine nationale Wirtschaft keine neuen Produkte oder Methoden erschafft und übernimmt.
Sie führt keine endogene Innovation durch.
Warum nicht?
Wenn die Wirtschaft als innovativ bezeichnet werden könnte,
also neue, vorher noch nicht erdachte Methoden und Produkte nutzt, wäre das laut Definition unerwartet.
Und das würde der Prämisse rationaler Erwartungen widersprechen, die besagt, dass es grundsätzlich nichts Unerwartetes gibt.
Die Modelle, die mit RE, also rationalen Erwartungen arbeiten, und das Phänomen der endogenen Innovation passen nicht zusammen.
RE-Modelle sind deterministisch, während jede Volkswirtschaft mit der Dynamik zur endogenen Innovation –
wie Carl Pauper es genannt hätte - offen für die Erschaffung ihrer Zukunft ist.
Die Zukunft einer dynamischen Wirtschaft ist nicht vorgegeben.
Nun, ich hoffe, dass die nächsten Absätze einigermaßen verständlich sein werden.
Sollte das aber nicht der Fall sein, machen Sie sich keine Sorgen.
Wir werden in wenigen Minuten in etwas ruhigerer See segeln.
Einige Neo-Schumpeterianer scheinen das Problem zu umgehen, indem sie eine Innovation als etwas definieren,
was dem zufälligen Stolpern über einen 5-Dollar-Schein auf der Straße entspricht.
Diese Theoretiker, zum Teil gute Freunde von mir, beschreiben eine im Wesentlichen statische Wirtschaft im mathematischen Sinne.
Die Kalenderzeit fließt in keine Gleichung ein – eine statische Wirtschaft,
in der die sogenannten Innovationen einem linearen Geburtsprozess mit einer bekannten Geburtswahrscheinlichkeit unterliegen.
In diesem Modell könnte die Wahrscheinlichkeitsverteilung der kumulativen Innovation
bis zu jedem angegebenen künftigen Datum errechnet werden,
so dass die Zukunft in einem probabilistischen Sinne vorherbestimmt ist.
Sie ist probabilistisch vorherbestimmt.
Das Modell schließt echte Innovation aus, indem es impliziert und sehr explizit aussagt, dass niemals etwas Neues
über die Potenzialitäten der Wirtschaftssysteme bekannt wird,
was die spätere Herstellbarkeit oder den Wert von Produkten belegen könnte.
Es gibt keinen Erfindungsprozess im Hayekschen Sinne.
Es kann kein neues wirtschaftliches Wissen in dieser neo-schumpeterianischen Welt geben,
weil die Struktur der Möglichkeiten und ihrer Wahrscheinlichkeiten bereits bekannt ist.
In den innovativen Wirtschaftssystemen, die in Großbritannien, Amerika, Deutschland und Frankreich im 19. Jahrhundert aufkamen,
waren die Wahrscheinlichkeiten und sogar die Möglichkeiten nie wirklich bekannt.
Das steht fest.
Schumpeter selbst – ich erwähnte die Neo-Schumpeterianer – war der Meinung,
dass er Standardökonomie und Innovation in Übereinstimmung gebracht hatte.
Er beobachtete, dass gelegentlich neues Wissen darüber entstand, was produziert werden könnte.
Aber er meinte oder vermutete, dass es von außerhalb einer nationalen Wirtschaft käme,
dass es von den Entdeckungen der Weltforscher und Wissenschaftler stammte.
Jemand, der dies übrigens bereits vor Schumpeter formuliert hatte, war 1904 Arthur Spiethoff.
Wenn die Wissenschaftler oder Forscher eine Entdeckung machen, nutzen die Unternehmer in jedem fortschrittlichen
kapitalistischen Wirtschaftssystem das, was er als offensichtliche Anwendungen des neuen Wissens bezeichnete.
In gewisser Weise sagt er uns – es sei denn, wir kapieren das nicht – dass Unternehmer über null Kreativität verfügen.
Diese neuen Kenntnisse über Produkte und Methoden, diese Schumpeterianische Innovation,
ist für eine Volkswirtschaft grundsätzlich exogen.
Sie steht allen Nationen zur Verfügung, auf jeden Fall denen, die bereit und in der Lage sind,
die die erforderlichen Organisationsstrukturen und Investitionen auf die Beine stellen.
Aber ich behaupte, dass die Innovationsprozesse, die die Welt von 1815 oder bis 1940
und in einem reduzierten Tempo in einigen Ländern bis 1965 oder so bewegt haben, größtenteils endogen waren.
Die meisten Historiker allerdings, sogar viele Wirtschaftshistoriker - ich denke da beispielsweise an Joel Mokyr,
mit dem ich in den vergangenen Monaten zu tun hatte, oder an Douglas North,
und wenn ich länger nachdenke,fallen mir wahrscheinlich noch viele andere ein –
interpretieren die Innovation in den innovationsstarken Volkswirtschaften als im Wesentlichen Schumpeterianisches Phänomen.
Und zwar, indem sie den wirtschaftlichen Fortschritt grundsätzlich der Zunahme von wissenschaftlichem Wissen
statt der Zunahme unternehmerischer Ideen zuschreiben, die von Geschäftsleuten stammen,
die sich orientieren, nachdenken, imaginieren und experimentieren, Dinge ausprobieren, herumbasteln usw.
Ihre Denkweise – ich habe versucht, das Muster nachzuvollziehen – scheint so zu sein,
dass wissenschaftliches Wissen, historisch betrachtet, immer oder verlässlich schneller wächst als der Bestand an Geschäftsideen.
Oder dass die Zunahme der früheren wissenschaftlichen Ideen im Sinne von wirtschaftlichem Fortschritt effektiver ist
als die Zunahme von unternehmerischen Ideen.
Schumpeter selbst sagte, dass ein Fortschritt in wissenschaftlichem Wissen …
Er wies darauf hin, dass eine Entdeckung durch Wissenschaftler oder Forscher mit Unternehmertum kombiniert werden muss.
Und er denkt dabei offensichtlich an das Wissen, dass die Unternehmer über die Funktionsweise der Wirtschaft haben
und darüber, was produziert werden kann und was nicht.
In gewissem Sinne führt Schumpeter also den Aspekt ein, dass wirtschaftliches Wissen auch eine Rolle spielt,
so dass bei einer Zunahme des wissenschaftlichen Wissens das Niveau des wirtschaftlichen Wissens eine Rolle spielt.
Ebenso könnte die moderne Theorie, die ich vorschlage und die die endogene Innovation betont, so formuliert werden,
dass der Fortschritt im Bestand an innovativen Geschäftsideen mit etwas wissenschaftlichen Wissen kombiniert werden muss.
Also der symmetrische Gegensatz zu Schumpeter.
Bei dem, was ich als Dynamik bezeichne, geht es nicht nur um die Tendenz, neue Ideen zu entwickelt.
Es geht auch um die Effektivität der neuen Ideen.
Ich glaube, dass die Schumpeterianer mit dem Folgenden Unrecht hatten.
Es stimmt natürlich, dass der Wissensstand von Geschäftsleuten für ihre Innovationsfähigkeit ziemlich wichtig ist.
Das sollte uns aber nicht zu dem Schluss verleiten, dass der spektakuläre Erguss von neuen Produkten und neuen Methoden von 1820
bis 1940 eher aus der weiteren Akkumulation von wissenschaftlichen Ideen als aus der Akkumulation von geschäftlichen Ideen stammt.
Wir wissen darüber so gut wie nichts.
Wir wissen nur, dass Wissen unterschiedlicher Art von Bedeutung ist.
Und neue Ideen sind bedeutend.
Und während die Innovationsfähigkeit einer Nation vom Umfang des Wissens der Hersteller und Nutzer abhängt,
umfasst solches Wissen nicht nur wissenschaftliches Wissen.
Es beinhaltet auch Industrieexpertise, Bildung, ein bisschen Mathematik
und, abhängig davon, was man betreibt, Musikwissenschaften oder Malereitheorie oder was auch immer.
Die Schumpeterianer machen aus der Wissenschaft einen Fetisch.
Und die Wirtschaftswissenschaftler lehnen sich einfach zurück und akzeptieren das ohne Widerrede,
was unfraglich ein gigantischer Fehler ist.
Ich habe über Dynamik gesprochen.
Ich habe den Begriff mehrmals benutzt, aber ich habe nicht wirklich viel darüber gesagt.
Die Dynamik ist etwas, was in einer Gesellschaft existieren muss, damit sie endogene Innovationen hervorbringen kann.
Präziser gefragt: Was sind die Elemente dieser Dynamik und was ist ihre Quelle?
Sicherlich hätten die umfassenden Innovationsaktivitäten im 19. Jahrhundert
ohne eine Reihe von wirtschaftlichen Freiheiten und Institutionen nicht stattgefunden.
Es musste auch eine kommerzielle Kultur geben.
Ein Unternehmen ist von der Einhaltung impliziter, typischerweise nicht klagbarer Verträge abhängig,
einer Kultur, die die Einhaltung von Zusagen voraussetzt.
Aber ein Wirtschaftssystem kann über die neuesten Institutionen und eine beneidenswerte kommerzielle Kultur verfügen,
ohne große Innovationsimpulstreiber zu besitzen - jedenfalls nicht im großen Stil -,
mit anderen Worten, ohne über genug dynamische Kraft zu verfügen, eine hohe endogene Innovationsrate zu erzeugen.
Die Elemente der Dynamik sind aus meiner Sicht der Spielraum für Innovation,
die Fähigkeit für Innovation und vor allem der Wunsch zur Innovation.
Damit eine breite endogene Innovationsströmung entsteht,
muss die Gesellschaft Unternehmen einen großen Innovationsspielraum gewähren.
Es besteht weniger Innovationsspielraum, wenn die Gesellschaft nicht bereit ist,
die Störungen und Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen, die oft, aber nicht immer mit Innovationen einhergehen.
Und es gibt auch wenig Spielraum für Innovationen, wenn die Eliten in vielen korporatistischen Ländern Außenstehende
mit neuen Ideen daran hindern können, in ihre Industrien einzutreten.
Oder wenn Branchen, in denen Neugründungen möglich wären,
durch staatlichen Schutz für etablierte Firmen vor neuem Wettbewerb abgeschirmt werden.
Patentansprüche und drohende Klagen schrecken jeden ab,
der mit dem Ziel einer Innovation vor Augen ein Unternehmen gründen möchte.
Woraus besteht diese Fähigkeit zur Innovation?
Die Innovationsfähigkeit hängt von den persönlichen Ressourcen eines Menschen ab, am geläufigsten das eigene Wissen.
Jede Innovation erfordert spezielles Wissen sowie angemessenes Allgemeinwissen,
wenn auch in den frühen Tagen viele Innovatoren für ihren Analphabetismus und ihre Unfähigkeit zu rechnen bekannt waren.
Innovatoren im Musikgeschäft müssen etwas über die Kompositionstheorie wissen.
Akteure im Bereich der Pharmazie müssen etwas über Chemie wissen.
Man ist weitgehend der Meinung, dass praktisch jede Innovation heutzutage
wissenschaftsbezogene Erkenntnisse, Informationstechnologie, Ingenieurswesen und Mathematik erfordert.
Aber diese Perspektive geht fälschlicherweise davon aus,
dass die einzigen verbliebenen Innovationsmöglichkeiten heutzutage im Hightech-Bereich liegen.
Und das ist eine völlig unbegründete Hypothese und meiner Ansicht nach auch ziemlich absurd.
Diese Innovationsfähigkeit erfordert auch geistige Ressourcen, die kaum alle in einer Person vereint zu finden sind.
Vor allem geht es um Vorstellungskraft und Kreativität.
Das sind die beiden wichtigsten Wörter meines Vortrags heute Vormittag.
Aber wie jeder andere in der Welt kann ich gar nicht so schrecklich viel über die Vorstellungskraft und die Kreativität sagen,
außer, dass sie wirklich wichtig für Innovation sind.
Skepsis ist ebenfalls wichtig.
Innovatoren sind tendenziell Menschen, die bereitwillig vorherrschende Vorstellungen in Frage stellen
und bereit sind, selbstständig zu denken.
Eine weitere rare Ressource von Innovatoren ist die Einsicht.
Es reicht nicht, neue Dinge zu erfinden.
Man muss die richtigen neuen Dinge erfinden.
Henry Ford hatte eine Vision und die war absolut zutreffend.
Er hat nicht einfach nur ein neues Auto gebaut.
Er behauptete sogar gerne, dass nichts an diesem Auto neu war.
An diesem Fahrzeug gab es nicht ein einziges Element,
das nicht bereits in den Produkten der Wettbewerber in Detroit zu finden war.
Es ging vielmehr um die Wahrnehmung der Nachfrage, die ein solches Auto finden würde.
Ein Innovationsversuch ist so, als ob man eine Reise in das Unbekannte antritt.
Ambitionierte Innovatoren müssen verstehen, dass diese Reise lange Strecken des einsamen Nachdenkens bedeuten kann.
Und sie müssen sich stark genug fühlen, ein Scheitern zu verkraften, sollte ihr Unternehmen nicht erfolgreich sein –
offensichtlich also die Fähigkeiten, die bei Unternehmern üblich sind.
Die Arbeitsenergie, die Extroversion und das Urteilsvermögen, das sich aus Erfahrung speist,
stehen auf einem ganz anderen Blatt der Kompetenzen von Innovatoren.
Im Kern der dynamischen Kraft steht jedoch der Wunsch nach Innovation - trotz oder möglicherweise zum Teil wegen der Hindernisse.
Manche Innovatoren haben das tiefe Bedürfnis, anderen ihre enorme Vorstellungskraft
oder ihre seltene Auffassungsgabe zu demonstrieren, indem sie etwas Neues schaffen, das anerkannt und gemocht wird.
Strawinsky pflegte zu sagen, dass er seine großen Kompositionen geschrieben hat,
um den Freunden seiner Eltern zu beweisen, wie gut er ist.
Als er schließlich fertig war, waren die Freunde seiner Eltern schon alle gestorben.
Es gibt Innovatoren, die von der Neugier getrieben werden, herauszufinden, ob ihre Erkenntnisse sich als richtig erweisen,
ob die neue Sache zu ausreichend geringen Kosten hergestellt werden kann und ob damit ein ausreichend großer Markt zu erobern ist.
Andere Innovatoren sind von dem Bedürfnis getrieben,
sich selbst, nicht den Freunden ihrer Eltern, zu beweisen, dass sie erfolgreich sein können.
Diese Motive und Zielsetzungen kommen offensichtlich nicht aus der Mentalität von "arbeite und spare" des merkantilen Kapitalismus,
über den bekanntlich Max Weber um 1920 geschrieben hat.
Diese Zielsetzungen und Motive, die dem Innovationswunsch zugrunde lagen, waren meiner Meinung nach
von den modernen Werten bewegt, die bereits in der späten Renaissance einzusetzen begannen.
Der Individualismus von Pico Della Mirandola und Luther: Verantwortung für das eigene Leben übernehmen,
was eigenständiges Denken und die Bereitschaft beinhaltet, mit Konventionen zu brechen.
Der Vitalismus, der von Cellini, Cervantes und Shakespeare verkörpert wird:
Herausforderungen zu genießen, Hindernisse zu überwinden und Zeichen zu setzen.
Und schließlich der Expressionismus oder der Experimentalismus von Kierkegaard und Nietzsche:
der Kick der Faszination des Aufbruchs in das Unbekannte und die Selbstfindung, die daraus resultiert.
Diese Werte haben Menschen auf einen Karriereweg geführt, der die persönliche Weiterentwicklung ermöglicht,
das „Werden“, über das Montaigne und Henri Bergson bekanntermaßen geschrieben haben.
Als Menschen das Neue erschufen, erschufen sie sich selbst.
Diese modernen Werte standen im scharfen Kontrast zu den traditionellen Werten des Mittelalters oder der Antike.
Und welche waren das konkret?
Materialistische Werte, die die Erkundung um ihrer Selbstwillen unterminierten, kommunitaristische Werte, die sich neuen
Unternehmen und neuem Geld widersetzten, und Familienwerte, die große Chancen vereitelten, bei denen man Haus und Hof riskiert.
Nach einer langen Zeit des Heranreifens haben die modernen Werte, so mein Argument, das zur Welt gebracht,
was ich als die moderne Wirtschaft bezeichne, eine Wirtschaft, die bis zur Basis der Gesellschaft reich an dynamischer Kraft ist.
Sehr viele Menschen, auch einfache Leute, haben regelmäßig beobachtet, erforscht, getüftelt,
imaginiert, konzipiert, kreiert, experimentiert, getestet und vermarktet.
Viele haben bei der Einführung neuer Produkte eine etwaige Annahme untersucht, ausprobiert und umgesetzt.
Eines der Ergebnisse war eine Innovationsexplosion, die sich in dem beispiellosen Anstieg der Produktivität
von etwa 1820 bis 1940 und etwas abgeschwächt bis etwa 1965 in den Vereinigten Staaten gezeigt hat.
Das war eines der Ergebnisse der Innovationsexplosion.
Ein anderes Resultat war die Veränderung der Lebensweise.
Es gab einen Mann, von dem Sie vielleicht gehört haben, einen Juristen, der um 1858 für ein Amt kandidierte.
Im Laufe seines umfangreichen Austauschs und seiner Erfahrungen hatte er unglaublich viel über das amerikanische Volk gelernt.
Und er schrieb darüber einen Vortrag.
Der Titel lautete „Invention …“ - er hätte es Innovation nennen müssen, aber das ist okay.
Und dieser Mann war Abraham Lincoln.
Und es stellt sich heraus, dass der zweite Vortrag tatsächlich der erste Vortrag war, aber es war zu spät
und jeder nannte ihn bereits den zweiten Vortrag.
Und in diesem zweiten Vortrag sagt er:
Und man könnte ihn so verstehen, dass er damit gemeint hat, dass die Leute eine gute Zeit im Einkaufszentrum haben.
Aber ich glaube, er meinte das etwas weiter gefasst:
dass die Menschen nämlich Neuheiten sowohl bei der Arbeit als auch beim Einkaufen lieben.
Nun, ich behaupte, dass das ein gutes Wirtschaftssystem war.
Für mich symbolisiert der einsame Hirte, der gelangweilt von der Routine und isoliert vom Austausch mit anderen ist,
den Stillstand und die Verdummung, die für prämoderne Wirtschaftssysteme wie im merkantilen Kapitalismus charakteristisch war.
Die moderne Wirtschaft hat Langeweile durch geistige Stimulierung, Isolation durch Austausch
innerhalb von Unternehmen und innerhalb von Städten ersetzt.
Es entstand eine neue Dimension des Wohlstands, eine, die eher experimentell orientiert war als auf ein Ziel,
wie beispielsweise erhöhten Konsum oder Wohlstand ausgerichtet.
Der Weg ist das Ziel, wie ein Spruch besagt.
Moderne Menschen erlebten erstmalig umfassend eine prosperierende oder florierende Welt.
Dabei geht es um einen materiellen Wohlstand, der durch verbesserte Arbeitsbedingungen und Zugang zu dieser Erfahrung entsteht.
Und es geht dabei auch um den nicht-materiellen Wohlstand,
der aus der Annahme von Herausforderungen und Hoffnungen auf Anerkennung und Annahme entsteht.
Die modernen Menschen haben erstmalig das erlebt, was Philosophen als gutes Leben, als florierendes Leben bezeichnen –
eine Bezeichnung, die Aristoteles nach einhelliger Meinung heutiger Philosophen hätte wählen sollen.
Aber damals existierte wohl noch nicht das richtige Wort dafür.
Und Aristoteles benutzte unglücklicherweise das Wort Glück.
Für mich ist deutlich, dass wir die Standardökonomie überarbeiten müssen, damit sie auf all die Aspekte anwendbar ist,
bei denen die Dynamik im Sinne einer endogener Innovation von entscheidender Bedeutung ist.
Zum einen wirft die Berücksichtigung der Dynamik in der Analyse ein neues Licht darauf,
was eine Nation sich von ihrem Bildungssystem wünschen sollte.
Und sie wirft ein neues Licht auf den Ursprung der Ungleichheit von Wohlstand.
Ich möchte die Zeit nicht zu sehr überziehen.
Ich komme deshalb zu einem Punkt, über den Sie sicherlich noch etwas hören wollen.
Das ist die Ungleichheit.
Und dazu habe ich das Folgende zu sagen.
Als ich mein Buch „Mass Flourishing“ beendet hatte, war das Thema Ungleichheit noch nicht in aller Munde.
Ich glaube, das Wort kommt nicht einmal im Index vor.
Und dann kam Piketty.
Und alle haben Piketty gelesen und nur wenige haben mein Buch „Mass Flourishing“ gelesen. (Gelächter)
So beschloss ich, auch über Ungleichheit zu schreiben. (Gelächter)
Das konnte ich natürlich nicht mehr im Buch unterbringen.
Die Princeton University Press hätte das wohl kaum mitgemacht.
Aber ich habe vor ungefähr einem Monat einen Beitrag für die Financial Times geschrieben.
Etwas über die maskierte Wirtschaftstheorie, was sie als Beitrag für die Zeitung angenommen haben.
Neue Themen ziehen unsere Aufmerksamkeit weg von den Problemen, über die ich gesprochen habe:
das langsame Wachstum, die schlechte Arbeitsmarktlage, der Ausdruck von geringer Arbeitszufriedenheit.
Unsere Aufmerksamkeit wird auf die Ungleichheit gelenkt.
Man geht davon aus, dass in Europa ein Viertel des Privatvermögens im Besitz von 1% der Bevölkerung ist, in Amerika ein Drittel.
In Ländern, in denen sich das Wachstum verlangsamt hat, hat sich dieser Reichtum im Verhältnis zum Nationaleinkommen vervielfacht.
Der Anteil, der sich im Besitz der Reichen befindet, hat in den letzten Jahrzehnten in den meisten Nationen zugenommen.
Ich möchte betonen, dass ich mich mein ganzes Berufsleben lang für wirtschaftliche Gerechtigkeit interessiert habe
und daher auch für die ungerechten Ungleichverteilungen, die bis in die 1960er- und 1970er-Jahre zurückgehen.
Ich bin also in Bezug auf diese neue Diskussion nicht taub.
Ich habe mich gefragt, ob der Rückgang endogener Innovation in der westlichen Welt
möglicherweise eine Ursache für die zunehmende Ungleichheit bei der Vermögensverteilung ist.
Ich habe gerade eine dreiseitige Abhandlung übersprungen, in der ich über den Rückgang der Innovation spreche.
Und der Nachweis dafür ist natürlich ein abrupter Rückgang in der Wachstumsrate der totalen Faktorproduktivität 1972 in Amerika.
Wenn Sie weitere Belege dafür wollen, können Sie sich Rentabilität anschauen.
Stützt die Innovation die Rentabilität, wie dies in der Vergangenheit immer der Fall gewesen ist?
Nein, nach 1972 sank die Rentabilität.
Es ist interessant, dass die Zunahme der Ungleichheit des Vermögens als ein weiteres Symptom
dieser Verlangsamung der Innovationsdynamik betrachtet werden könnte.
Lassen Sie mich schnell auf den Punkt kommen.
Ich behaupte, dass Verluste in der dynamischen Kraft, die Innovation fördert,
die Ungleichheit bei der Vermögensverteilung tendenziell aufgebläht haben.
Die riesigen Innovationsrückgänge in den 1960er-Jahren haben vor allem in den USA
die Arbeitseinkommen stärker als die Wohlhabenden getroffen.
Weniger Projekte zur Entwicklung neuer Produkte und weniger Fabriken in der Herstellung von Investitionsgütern, die neue Produkte
herstellen, von denen die meisten wenig arbeitsintensiv sind, bedeuten, dass ein reduzierter Anteil in Arbeitseinkommen fließt.
Aus diesem Grund sind auch die Gewinne abgerutscht, aber die Reichen investierten zum Teil im Ausland.
Meine Hauptaussage lautet jedoch, dass ein Großteil der Innovationsverluste aus der Verbreitung korporatistischer Werte stammt,
insbesondere Solidarität, Sicherheit und Stabilität.
Und korporatistische Leitlinien, die Arbeit und Kapital durch wettbewerbsfeindliche Vorschriften schützen.
Die Sorge um Interessengruppen in Form von Klientelpolitik und Industrierichtlinien, die diejenigen blockieren oder beeinträchtigen,
die Innovationsversuche unternehmen oder ihre Leistungsanreize reduzieren würden, um innovativ sein zu können.
Welche Effekte hat das auf die Gewinnbeteiligung?
Wenn etablierte Unternehmen weniger Wettbewerb zu fürchten haben, weil es für Innovatoren im Großteil der Wirtschaft
schwieriger wird, werden etablierte Unternehmen ermutigt, ihre Aufschläge und damit ihre Gewinne anzuheben.
Es gibt keinen funktionierenden Wettbewerb, der diesen Anteil wieder verringert.
Dadurch steigen wiederum die Aktienkurse, also das Vermögen der bereits vermögenden Anteilsinhaber.
Lassen Sie mich schnell noch zwei weitere Punkte ansprechen.
Ein weiterer korporatistischer Wert, der Materialismus, verstärkt ebenfalls die Ungleichheit in der Vermögensverteilung.
In Standardwirtschaftssystemen sparen die Menschen Geld von ihren Löhnen, um Vermögen zu erwerben, das sie ausgeben können.
In der andauernden Schufterei für mehr und mehr Wohlstand ist in der Standardtheorie niemand geizig.
Das erneute Auftreten des Materialismus hat einfach eine Fixierung auf das Reichwerden mit sich mitgebracht.
Aktuelle Daten weisen darauf hin, dass die Menschen selbst im Ruhestand noch sparen.
Sie sparen immer noch - wie Aufziehmännchen, die nicht mit dem Sparen aufhören können.
Ein letzter Punkt: Der Materialismus hat zu kurzfristigen Perspektiven geführt.
Er veranlasst CEOs dazu, die Aktienkurse hoch zu treiben und verleitet Fondsmanager dazu,
von den CEOs das Erreichen ihrer Quartalsgewinnziele zu verlangen.
Das lenkt diese von ihren potenziellen langfristigen Visionen ab.
Gesellschaften erhöhen Bonuszahlungen über Rückkäufe, um Aktienkurse aufzublähen.
All das erzeugt einen zusätzlichen Abwärtsdruck auf Innovation und fördert die Ungleichheit der Vermögensverteilung.
Nachdem die Innovation, gemessen am Produktivitätswachstum, in den USA zwischen 1965 und 1975,
der Periode des sich verlangsamenden US-Wachstums, zurückging, sind die Gewinne im Verhältnis zum BIP auf Rekordhöhen gestiegen
und liegen die Kursgewinnverhältnisse weit außerhalb des normalen historischen Bereichs.
Die erfolgreiche Wiedererlangung unserer dynamischen Kraft würde nicht nur für mehr Beschäftigungswachstum und
Arbeitszufriedenheit sorgen, sondern auch die Ungleichheit in der Vermögensverteilung reduzieren.
Vielen Dank.